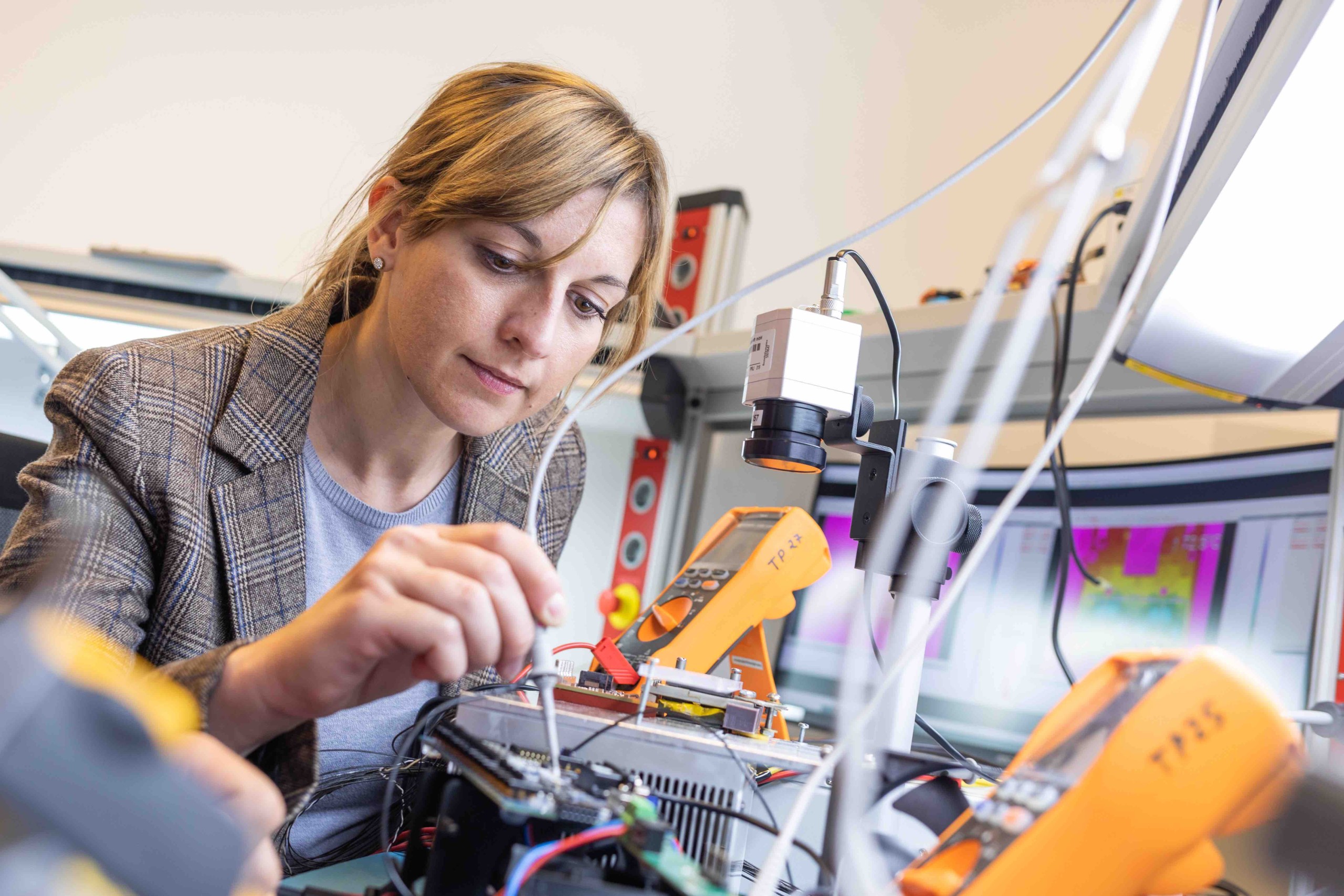Erika Thümmel leitet ihr eigenes Atelier für Ausstellungsgestaltung und Restauration in Graz. Am Institut für Design & Kommunikation unterrichtet sie unter anderem im Bereich Szenografie.
Die Szenografin Erika Thümmel im Interview
FH JOANNEUM, 28. April 2020
Sie sagen Sie lieben Ausstellungen?
Erika Thümmel: Ich mag Ausstellungen, weil ich mich frei durch ein Thema bewegen kann, selbst den Weg bestimme und die Dauer, die ich einem spezifischen Aspekt widmen möchte. Und ich schätze die Ernsthaftigkeit, mit der seriöse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Themen erforschen und an Laien kommunizieren. Es ist ein Gegenpol zu einer völlig von kommerziellen Zwecken getriebenen Welt, denn sogar bei einer interaktiven Firmenpräsentation wird seriöser Wissensvermittlung beträchtlicher Platz eingeräumt. Und das nicht nur über Text und (Bewegt-) Bild, sondern auch mit alltags-, kunst- oder kulturgeschichtlichen Originalen. Das ist ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal, das nicht geopfert werden sollte.
Aber ich mag auch die außergewöhnlichen Gebäude, die ich dank Ausstellungen auf mich einwirken lassen kann: Kunsthäuser von den besten Architekten unserer Zeit, wertvolle Paläste und Burgen, aber auch ungewöhnliche Orte, an die ich sonst nie kommen würde: alte Gefängnisse, Industrieanlagen, private Häuser, Naturschönheiten usw. Vor allem aber liebe ich die Überraschung, das Unerwartete, das alle Sinne umfassende Erlebnis im realen 3D Raum. Das sind Erfahrungen, an die ich mich noch Jahrzehnte später erinnere.
Was hält Sie nach wie vor in diesem Feld?
Thümmel: Man lernt so viel, da man sich immer mit neuen Thematiken beschäftigen muss, mit Themen, mit denen man sich nicht aus eigenem Interesse beschäftigt hätte. Und man lernt oft außergewöhnliche Menschen kennen, Frauen und Männer, die für etwas brennen, muss sich mit diesen auseinandersetzen und zusammenarbeiten. Das ist nicht immer einfach, aber bereichernd. Mich fasziniert auch die Komplexität der Aufgabenstellung. Wie bei einer Regiearbeit müssen alle Details im Auge behalten werden und sehr viel gleichzeitig bedacht und in Einklang gebracht werden. Und dann kommt der magische Moment, an dem das, woran man Wochen, Monate oder Jahre geplant und getüftelt hat, aufgebaut wird, wunderbar und mit Mängeln. Und ich weiß, das klingt komisch: Aber ich finde diese Beschäftigung oft spannender als das, was uns ständig als Freizeitbeschäftigung verkauft wird.
Was ist Ihnen am wichtigsten bei einer Ausstellung?
Thümmel: So etwas wie Poesie. Man kann es auch als Atmosphäre bezeichnen. Und gleichzeitig gut aufbereitete, strukturierte und verständliche Informationsaufbereitung, bei der die potentiellen BesucherInnen und ihre Fragen an ein Thema ernst genommen werden.
Wie begann Ihre Leidenschaft für Ausstellungen?
Thümmel: Als ich circa 13 Jahre alt war, wurde ich von meinen älteren Schwestern mitgenommen ins Künstlerhaus Graz zu einer Trigonausstellung des Steirischen Herbst. Inspiriert von den Objekten der Künstler errichtete ich daraufhin zu Hause im Garten aus Tomatenstangen Skulpturen. Kurze Zeit später organisierten meine Geschwister einen „Hausball“ in der elterlichen Wohnung, dieser wurde mit meinen Objekten dekoriert und irgendwer aus der Runde stellte meine Kunstwerke vor.
Zehn Jahre später — ich hatte mein Studium der Restaurierung abgeschlossen und arbeitete als freischaffende Künstlerin — begannen meine „Lehrjahre“ im Bereich Ausstellungen. Ich war zwischen 1986 und 1999 zuständig für die Betreuung der Leihgaben für zwölf Steirische Landesausstellungen, arbeitete im Auf- und Abbau, dem Objektdisplay und dem Bereich der Kunsttransporte. Und Landesausstellungen waren zu dieser Zeit echte Blockbuster mit teilweise mehr als 300.000 Besucherinnen un Besuchern in einem halben Jahr. Bei dieser Arbeit habe ich auch Karl Stocker kennengelernt. Diese Zeit war sehr inspirierend. Aber ich sah im Laufe der vielen Jahre auch viele Fehler und bekam Lust, eigene Ausstellungen zu gestalten. Ich wollte es besser machen. Jetzt weiß ich, wie schwierig das ist, und werde in meinem Urteil milder.
Ja, und dann gab es noch die Ausstellungen von Bernhard Rudofsky, die mir die Augen öffneten für ganz neue Zugänge (Sparta und Sybaris hatte ich 1987 in Wien im MAK gesehen) und später 1997 Das Archiv des Visionärs, eine Ausstellung über Friedrich Kiesler im Wien Museum.
Wo liegen die Grenzen einer (guten) Ausstellung?
Thümmel: Für mich gibt es zwei Grenzen, oder vielleicht Pole: die wissenschaftliche Seriosität und die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung. Dazwischen liegt ein unendlich weites und vielfältiges Feld, eines auf dem sich — wie bei jeder künstlerischen Gestaltung — immer Neues entdecken, ausprobieren und erforschen lässt. Neue Zusammenhänge können hergestellt werden, neue Fragen aufgeworfen und neue Sichtweisen erfahrbar gemacht werden. Es ist wie Film, Theater und Musik: nie ein Ende erreichend und immer auf der Suche nach Neuem.